Die „autogerechte Stadt“: Ein Relikt der Vergangenheit oder eine bleibende Herausforderung? Die neueste ENTWICKLUNGSSTADT Reihe analysiert das umstrittene Leitbild und seine Folgen und zeigt, wie West-Berlin zum Schauplatz einer urbanen Transformation wurde.

Im West-Berlin der Nachkriegsjahre wurde das Konzept der „autogerechten Stadt“ geplant und umgesetzt – mit weitrechenden Folgen. / © Foto: IMAGO / serienlicht
© Foto Titelbild: IMAGO / serienlicht
ENTWICKLUNGSSTADT Reihe: Abschied von der autogerechten Stadt – Realität oder Utopie?
von Wolfgang Leffler
Prolog
Verfolgt man die seit Jahren geführten Diskussionen und in vielen Publikationen anschaulich dargestellten Grundsätze und Leitgedanken zum Themenkomplex „Abschied von der autogerechten Stadt“, dann fragt man sich, ob das nur ein Modebegriff ist oder ob die verantwortlichen Stadt- und Verkehrsplaner tatsächlich ihre momentanen und zukünftigen Planungen danach ausrichten.
Dieses Thema ist nicht nur für die deutsche Hauptstadt ein zentrales Thema, sondern auch für viele Großstädte und Städte mittlerer Größe in Deutschland, aber auch in Europa, dem transatlantischen und asiatischen Raum von besonderer Relevanz.
Hans Bernhard Reichow: „Die autogerechte Stadt“ aus dem Jahr 1959
„Die autogerechte Stadt“ ist der Titel eines Buches, das der Architekt und Stadtplaner Hans Bernhard Reichow 1959 im Auftrag des damaligen Bundesministeriums für Wohnungsbau geschrieben hat.
Betrachten kann man eine Originalausgabe dieses Buches in der derzeitigen Ausstellung des Werkbundarchivs – Museum der Dinge – unter dem Motto „Profitopolis oder der Zustand der Stadt“, in Berlins Mitte, Leipziger Straße 54.
Das Ziel: Wege aus dem Verkehrschaos zahlreicher nationaler und internationaler Großstädte
Das Thema der Ausstellung deutet eigentlich darauf hin, worum es in Reichows Buch im speziellen geht – einen Weg aus dem Verkehrschaos zu finden, der in den Großstädten nach wie vor herrscht.
Hans Bernhard Reichow war einer der entschiedensten Verfechter der Idee einer „autogerechten Stadt“, und wer sich der Mühe unterzieht, dieses Buch zu lesen und zu verstehen, wird erkennen, dass der Autor mit seiner Publikation ein epochales Standardwerk geschaffen hat, das mit seinen dargestellten Konzeptionen und Überlegungen zur Überwindung des Verkehrschaos aktueller erscheint denn je.
Die ersten Straßen und Gassen der Städte entstanden lange Zeit vor der Erfindung des Automobils
Der Sinn der Konzeption bestand darin, die vor Jahrhunderten gegründeten Städte, deren Stadtgrundrisse mit ihren engen Straßen und Gassen noch aus dem Mittelalter stammen und deren Entstehung weit vor der Entwicklung des Automobils lag, den Mobilitätsbedürfnissen des modernen Automobilverkehrs anzupassen.
Reichow formuliert das in seinem Buch wie folgt: „Seit Jahrtausenden hat sich der Verkehr noch nie so völlig verändert und so eindeutig einen neuen Stadtgrundriss verlangt wie heute“. Weiterhin merkt er an, dass die „Chance dazu bestand nach dem Ende des zweiten Weltkriegs und dem darauffolgenden notwendigen Wiederaufbau der kriegszerstörten Städte.“
Die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs als Wegbereiter für die Schaffung der „autogerechten Stadt“
Mit dieser Auffassung stand Reichow nicht allein da, sondern eine ganze Architektengeneration hatte die Kriegszerstörungen als große städteplanerische Chance erkannt. Einer der prominentesten Vertreter dieser Denkweise war auch Le Corbusier, der quasi als einer der wichtigsten ideologischer Wegbereiter der „autogerechten Stadt“ galt.
Die Verkehrs- und Stadtplaner der sechziger und siebziger Jahre übertrugen diese Konzepte in den verkehrstechnischen Funktionalismus und erkannten bereits damals, dass der Umbau der Städte zur autogerechten Stadt weit über die Lösung reiner Verkehrsprobleme hinausging – vielmehr spiegelte er einen gesellschaftlichen Konsens wider.
Die Planung unserer Städte: Gesellschaftlicher Konsens und notwendige Zusammenarbeit
Dieser gesellschaftliche Konsens verlangt intelligente Lösungen und eine Zusammenarbeit verschiedenster Resorts, wo festgezurrte Claims zu überwinden sind.
Ist es tatsächlich so, dass bei Nennung der „autogerechten Stadt“ sich manche müde lächelnd abwenden und meinen, dass wir es hier nur mit einem Schlagwort zu tun haben, wie „Urbanität durch Dichte“?
Verkehrsplanung des 21. Jahrhunderts: Ein Balanceakt zwischen Anspruch und Realität
Haben denn die Hochstraßen, Stadtautobahnen, Straßendurchbrüche sowohl für die Autofahrer als auch die anderen Straßennutzer das gebracht, was als Verbesserungen versprochen wurde? Nein, denn man steht immer noch zu lange im Stau und die anderen Straßenbenutzer müssen sich mit dem verbleibenden Rest an Straßenraum begnügen. Von den gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Abgase ganz zu schweigen.
Die aktuell veröffentlichten Zahlen zu Stauzeiten in deutschen Großstädten und die im Jahr 2024 in Berlin zu Tode gekommenen Verkehrsteilnehmer sprechen eine deutliche Sprache, die wenig Anlass zum Optimismus lässt.
Die „autogerechte Stadt“: Ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde
Was also ist die „autogerechte Stadt“? Autogerecht kann bedeuten, dass der Individual – bzw. notwendige Lieferverkehr absoluten Vorrang hat und der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf geringem Niveau nebenherläuft oder noch rationaler ausgedrückt: Eine autogerechte Stadt ist eine an den Bedürfnissen des motorisierten Individualverkehrs orientierte Stadt.
So formulierte es auch Reichow in seinem Buch und weist darauf hin, dass sich die Stadtplaner beim Neu-bzw. Wiederaufbau der Städte nach dem Zweiten Weltkrieg an der das Automobil favorisierenden Charta von Athen (CIAM) von 1933 orientierten.
Als Ergebnis dessen entstanden sogenannte „suburtane Satellitenstädte“ (Schlafstädte), da man Wohnen und Gewerbe bei den Planungen voneinander getrennt hat. Nach heutigen Erkenntnissen wird dieses Konzept der „autogerechten Stadt“ kritisch und als nicht nachhaltig bewertet und gilt zumindest in unseren Breitengraden als warnendes Beispiel.
Das West-Berlin der Nachkriegsjahrzehnte: Wo die „autogerechte Stadt“ im großen Stil geplant und umgesetzt wurde
Dieser Prolog zur Reihe „Abschied von der autogerechten Stadt“ ist der Beginn einer Reise durch die Geschichte, Gegenwart und Zukunft der „autogerechten Stadt“ und wird zeigen, wie das Konzept von den damaligen Stadtplanern in West-Berlin geplant und umgesetzt wurde, welche Hoffnungen und Probleme es mit sich brachte und wie es bis heute die urbane Landschaft prägt.
In den nächsten Beiträgen analysieren wir die planerischen Leitbilder, gesellschaftlichen Debatten und die langfristigen Auswirkungen auf die Stadtentwicklung des damaligen und heutigen Berlin. Dabei wollen wir nicht nur vergangene Fehler aufzeigen, sondern auch Perspektiven entwickeln, wie Städte künftig ökologischer, gerechter und zukunftsfähiger gestaltet werden können.
Fortsetzung folgt…

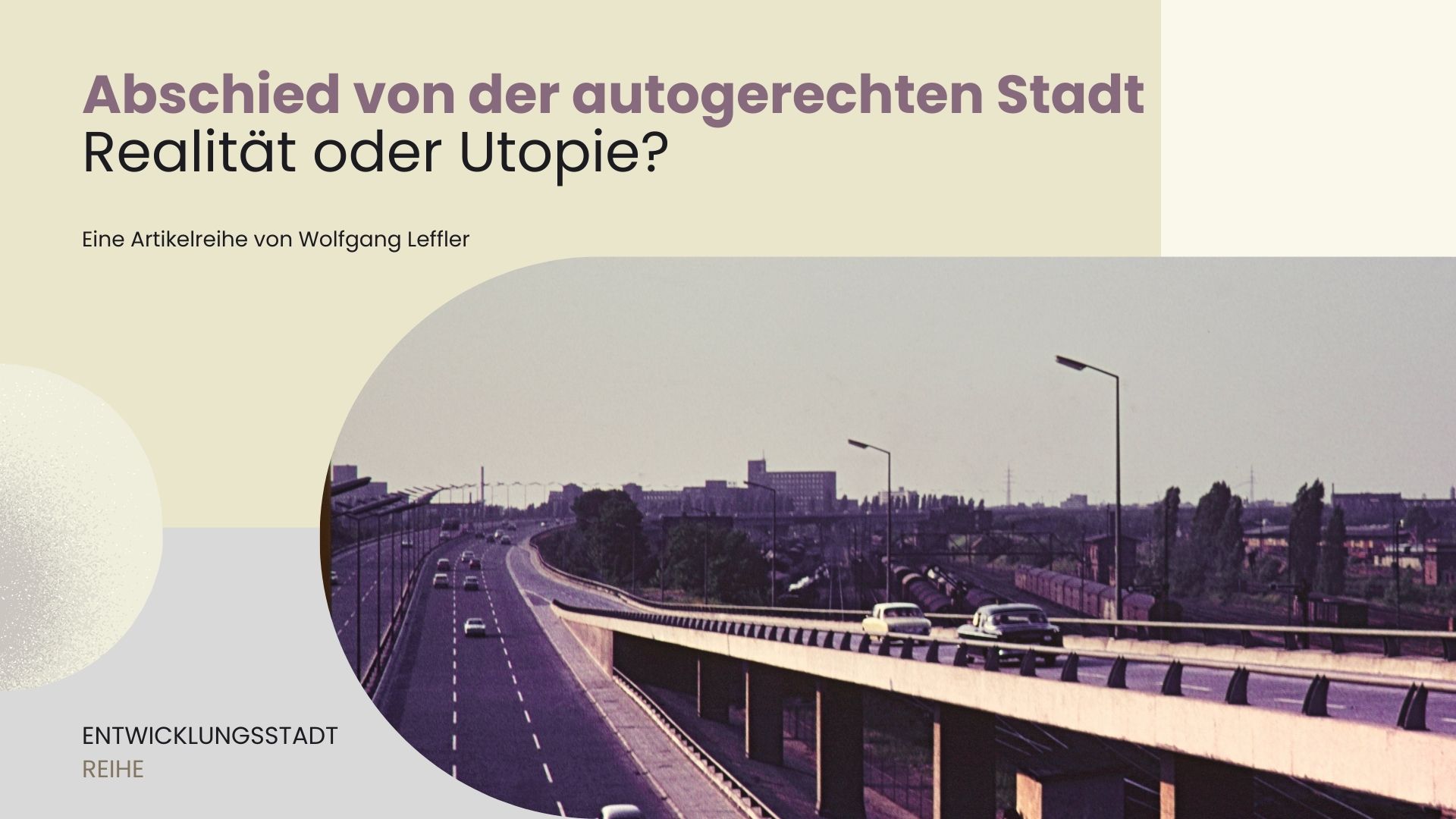



Die ganze Debatte ist von extremen geprägt. In den 50,60,70er Jahren hatte man radikale Gedanken zur autogerechten Stadt, führte Autoschneisen mitten durch Wohngebiete und den Stuck konnte man dabei ja auch gleich noch wegreißen. Heute wiederum das andere extrem. Völlig unnötig wird Parkraum künstlich verknappt. Yuppies beschweren sich über die Störung des Stadtbildes durch parkende Autos. Spuren werden verengt. „Pop-up“ Radwege sorgen für Verwirrung. Der ideologische „Krampf“ könnte nicht schlimmer sein. In Berlin wird gleich auch noch das Licht auf der Stadtautobahn ausgeknippst. Verrückte Welt. Ich wünsche mir eine vernünftige Verkehrspolitik. A100: ja, verdammt nochmal, die Mittel sind längst genehmigt, es verbessert die Situation tausender Berliner. Parkplätze erhalten? Ja, natürlich, warum sollte man denn diese völlig unnötigerweise abschaffen? Gebäude wieder bestucken und mehr Schönheit in unsere Städte zurückholen? Ja, ja und ja!
Im Grunde genommen hatten die Nationalsozialisten das Thema längst vorher losegtreten (siehe Berlin mit Autobahnring und fetter Trassen oder auch die Stuttgartplanungen). Da paßt es geradezu folgerichtig, dass der Antisemit par excellence, Hitlerverehrer und Petain-Kollaborateur Le Corbusier damit weitergemacht hat…
Einfach traurig, es wird nicht weniger Autos geben. Ich sage nur, die Brücke am Breitenpachplatz…. Sobald der Tunnel saniert ist, werden sich hunderte von Autos über drei Ampeln quälen und der aufschrei wird kommen, dass es so nicht weitergehen kann. Stau, Stau, Stau….Doch dann ist die Brücke, über die sich damals alle gefreut haben, weg und es wird alles getan damit dort keine neue Brücke mehr gebaut werden kann. Ich frage mich, wer sowas einfach entscheiden darf, ohne auf die Anwohner einzugehen.