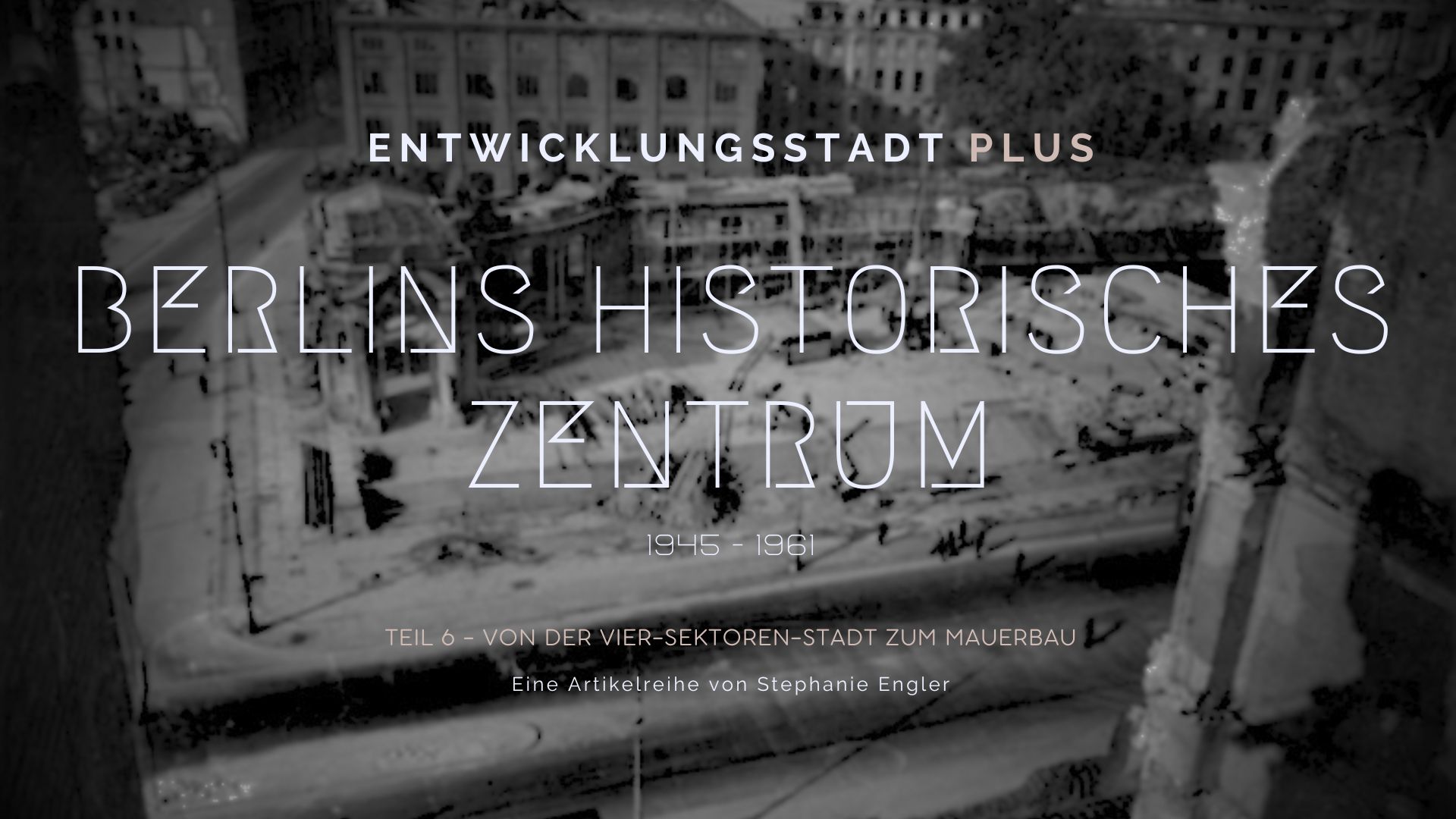Die Jahre zwischen 1945 und 1961 markieren einen historischen Wendepunkt in der Geschichte Berlins. Aus einer vom Krieg zerstörten Hauptstadt entwickelt sich eine politisch gespaltene Doppelstadt. Der sechste Teil unserer Reihe zeichnet die Entwicklung vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zur Errichtung der Berliner Mauer nach – zwischen Wiederaufbau, Kaltem Krieg und urbaner Zäsur.
© Fotos: Wikimedia Commons
Als am 2. Mai 1945 die Berliner Garnison kapituliert, markiert dies das faktische Ende des Zweiten Weltkriegs für Europa und die Hauptstadt. Dabei liegt Berlin – insbesondere die Altstadt mit dem Molkenmarkt, dem Nikolaiviertel und der Spreeinsel – nun weitgehend in Schutt und Asche. Rund 600.000 Wohnungen sind zerstört, große Teile der Innenstadt unbewohnbar. Von vormals 4,3 Millionen Einwohnern leben noch 2,8 Millionen in der Stadt.
Die Infrastruktur – von Wasserleitungen über Energieversorgung bis zum Nahverkehr – ist schwer beschädigt, viele Kulturdenkmäler sind stark zerstört oder vollständig verloren. Der Wiederaufbau beginnt unmittelbar nach Kriegsende, ist jedoch geprägt von Materialknappheit, improvisierten Bautechniken und der politischen Unsicherheit einer Stadt unter alliierter Verwaltung.
Berlin 1945: Städtebaulicher Neuanfang unter alliierter Aufsicht
Denn bereits im Februar 1945 hatten die Alliierten auf der Konferenz von Jalta beschlossen, Berlin in vier Besatzungszonen aufzuteilen. Und so übernehmen im Sommer amerikanische, britische und französische Truppen die ihnen zugewiesenen Sektoren. Die Stadt wird fortan von einer gemeinsamen alliierten Kommandantur verwaltet – ein fragiles Konstrukt, das bald durch die politische Realität zersetzt wird.
Und während die Trümmerfrauen und Räumkolonnen die Stadtoberfläche säubern, entstehen neue städtebauliche Konzepte. Die Visionen des vorkriegsmodernen Bauens werden reaktiviert, ergänzt durch neue, pragmatische Ideen des sozialen Wohnungsbaus. Dabei entwickelt sich ein Planungsbild, das stark von den jeweiligen politischen Verhältnissen geprägt ist. Ost- und West-Berlin nehmen ab diesem Zeitpunkt städtebaulich deutlich unterschiedliche Wege.
Geteilte Stadt: Zwei Systeme, zwei Ideologien – zwei städtebauliche Leitbilder
Die Nachkriegsjahre stehen im Zeichen wachsender ideologischer und städtebaulicher Gegensätze. Die Gründungen der Bundesrepublik Deutschland am 23. Mai 1949 und der DDR am 7. Oktober 1949 machen die Teilung Berlins dann endgültig. Beide Staaten beginnen, ihren jeweiligen Teil der Stadt nach eigenen Vorstellungen und politischen Idealen zu formen – sichtbar in Stein, Beton und Stadtstruktur.
Im Ostteil der Stadt wird der Wiederaufbau künftig zentral geplant. 1950 startet das „Nationale Aufbauprogramm“, das den Ausbau Ost-Berlins zur sozialistischen Hauptstadt vorsieht und sie architektonisch wie symbolisch ideologisch umgestaltet. Das Berliner Schloss wird im September 1950 gesprengt, die Große Frankfurter Straße zur Stalinallee – einem Prachtboulevard des Sozialismus, errichtet im sowjetischen Zuckerbäckerstil.
Es wird gezielt in Prestigeprojekte investiert, wie das Hochhaus an der Weberwiese oder den Wiederaufbau des Theaters am Schiffbauerdamm. Monumentale Wohnbauten mit reich verzierten Fassaden, großzügigen Eingangsbereichen und Kolonnaden prägen das Bild dieser neuen Stadtmitte. Es entsteht ein repräsentatives Zentrum, das den Anspruch der DDR auf Modernität und architektonische Überlegenheit symbolisieren soll. Besonders der zweite Bauabschnitt der Karl-Marx-Allee und Großsiedlungen wie das Neanderviertel in der Luisenstadt zeugen vom Wandel hin zum industriellen Wohnungsbau.
Städtebauliche Gegensätze in Ost- und West-Berlin: Aufbau im Zeichen der Systeme
Während Ost-Berlin also sozialistische Stadtplanung verfolgt, orientiert sich West-Berlin am Leitbild der modernen, autogerechten Stadt. Oder auch an den Ideen der „Charta von Athen“: Funktionstrennung, aufgelockerte Bebauung und eine klare Trennung von Wohnen und Arbeiten bestimmen die neue Baupolitik. Diese setzt gezielt auf Luft, Licht und Grün – sichtbar in neu angelegten Siedlungen und den ersten modernen Verkehrsachsen wie der Stadtautobahn, deren Bau 1956 beginnt.
Auch kulturelle und symbolische Neubauten bestimmen das Stadtbild: Der Zoo-Palast wird 1957 zur neuen Adresse der Berlinale, das Europa-Center sowie der moderne Neubau der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche symbolisieren ein West-Berlin, das sich als weltoffen, fortschrittlich und selbstbewusst präsentiert. Parallel dazu entstehen neue Quartiere wie das Hansaviertel oder das Studentendorf Schlachtensee – beide Ausdruck einer neuen urbanen Lebensweise.
Das Hansaviertel und die Interbau 1957: Moderne als Antwort
Denn besonders das Hansaviertel entsteht als architektonisches Gegenmodell zur monumentalen Ost-Bebauung. Auf dem stark zerstörten Areal westlich des Großen Tiergartens wird im Rahmen der Internationalen Bauausstellung (Interbau) 1957 ein städtebauliches Musterquartier errichtet. Namhafte Architekten wie Alvar Aalto, Walter Gropius und Oscar Niemeyer gestalten dort Wohnungen in frei stehenden Punkthochhäusern, Zeilenbauten und Pavillons. Der Kontrast zur stalinistischen Prachtstraße ist dabei bewusst gewählt und soll die Vorzüge moderner, offener Stadtplanung unterstreichen.
Zentrum des neuen Viertels wird die Kongresshalle im Tiergarten – ein Geschenk der USA an West-Berlin, das mit seiner markanten Dachkonstruktion bis heute als Symbol westlicher Architekturauffassung gilt. Auch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche am Breitscheidplatz wird nach Entwurf von Egon Eiermann zwischen Ruine und Neubau zum Mahnmal und Wahrzeichen zugleich. Sie verkörpert die Verbindung von Vergangenheit und Aufbruch auf eindrucksvolle Weise.
Wiederaufbau nach dem Krieg: Neue Berliner Quartiere für eine neue Gesellschaft
Während in Ost-Berlin die Karl-Marx-Allee weiter ausgebaut und mit dem Wohnkomplex Friedrichshain (ab 1956) ergänzt wird, entstehen im Westen ganze neue Stadtquartiere. Die Ernst-Reuter-Siedlung (1953/54) im Wedding, die Otto-Suhr-Siedlung in der Luisenstadt (ab 1956) und das Ruhwaldparkviertel gehören zu den ersten großen Wohnbauprojekten.
Der Fokus liegt dabei auf bezahlbarem Wohnraum, modernem Komfort und aufgelockerter Bebauung mit Grünbezug. Diese Konzepte werden zu Trägern einer neuen Gesellschaftsvision, die sich im Bauen manifestiert. Ab 1960 entsteht mit dem Falkenhagener Feld in Spandau die erste Westberliner Großsiedlung mit rund 8.000 Wohnungen. Parallel beginnt der Bau der Gropiusstadt im Süden Berlins – eine Trabantenstadt, die mit 17.000 Wohnungen ein neues Kapitel der urbanen Massenwohnungsarchitektur einläutet.
Stadtbild und Architektur als Ausdruck ideologischer Deutungshoheit
Auch symbolische Gebäude und Plätze erhalten in dieser Zeit eine neue Bedeutung. Die Sprengung des Berliner Stadtschlosses und der gleichzeitige Ausbau des Marx-Engels-Forums markieren das bewusste Abwenden vom preußischen Erbe. Statt Historismus dominiert sozialistische Moderne, die sich in Wohnhochhäusern, Kulturhäusern und Verwaltungsbauten ausdrückt. Architektur wird zu einem Sprachrohr der neuen Ordnung.
West-Berlin hingegen erhält mit dem Europa-Center, dem Neubau der Deutschen Oper (1957) und der Staatsbibliothek an der Potsdamer Straße ein neues urbanes Gesicht. Die Freie Universität Berlin in Dahlem entwickelt sich zum architektonischen Ensemble mit eigenen Campusbauten und dem Studentendorf Schlachtensee – ein deutlicher Ausdruck westlicher Bildungs- und Bauideale.
13. August 1961: Der Tag, an dem Berlin zur Mauerstadt wird
Doch die Trennung der Hauptstadt soll bald noch markanter werden. Denn die anhaltende Fluchtbewegung aus der DDR bringt das SED-Regime unter massiven Druck. Allein im Juli 1961 verließen über 30.000 Menschen das Land. So wird am 13. August die innerstädtische Grenze abgeriegelt – zunächst mit Stacheldraht, dann mit Beton – und über Nacht entsteht die Berliner Mauer.
Der Bau der Mauer beginnt in den frühen Morgenstunden. DDR-Grenztruppen und Volkspolizei errichten zunächst provisorische Sperranlagen mit Stacheldrahtverhauen, Straßensperren und Wachtposten. Bereits zwei Tage später folgen massive Betonmauern und Hohlblocksteine. Die physische Barriere wächst rasch zu einem komplexen Grenzsystem mit Todesstreifen, Wachtürmen, Kontrollpunkten und Panzersperren.
Der Verlauf der Mauer und ihre Auswirkungen auf das Stadtbild
Für die folgenden 28 Jahre, 2 Monate und 28 Tage umschließt die Berliner Mauer West-Berlin auf einer Länge von etwa 155 Kilometern. Ihr Verlauf orientiert sich an der administrativen Grenze zwischen dem sowjetischen und den drei westlichen Sektoren. Sie zieht sich vom nördlich gelegenen Rosenthal und der Bösebrücke in Pankow über den Wedding, Mitte, Kreuzberg, Neukölln und Treptow bis zum Südwesten Berlins, durch Zehlendorf und entlang des Teltowkanals bis zum Griebnitzsee.
Besonders dramatisch ist die Situation in der Bernauer Straße, wo der Bürgersteig zu West-Berlin gehört, während die Häuserfronten in Ost-Berlin stehen. Menschen springen dort aus den Fenstern in die Freiheit – bis auch diese zugemauert werden. Ganze Straßenzüge, Friedhöfe, Wasserläufe und Gleisanlagen werden brutal durchschnitten. Züge halten nicht mehr an, S-Bahn-Linien werden unterbrochen, einst belebte Plätze wie der Potsdamer Platz werden zur urbanen Wüste.
Berlin als Symbol des Kalten Krieges und geteilte Hauptstadt Europas
Westliche Truppen beobachten den Bau der Mauer, greifen jedoch nicht ein – ihre alliierten Zugangsrechte nach West-Berlin bleiben formal gewahrt. In den Tagen nach dem Mauerbau demonstrieren führende westliche Politiker ihre Präsenz in der Stadt. Doch die Berlinerinnen und Berliner stehen vor einer neuen Realität: Die Mauer zementiert nicht nur die Spaltung der Stadt, sondern wird zum global sichtbaren Symbol der Systemkonkurrenz zwischen Ost und West.
Über 28 Jahre lang bleibt sie Ausdruck des Kalten Krieges – als sichtbare und unüberwindbare Trennlinie mitten in Europa. In dieser Zeit sterben nach aktuellem Forschungsstand mindestens 140 Menschen beim Versuch, die Mauer zu überwinden. Erst am 9. November 1989, im Zuge des politischen Umbruchs in der DDR und des Drucks einer reformwilligen Bevölkerung, fällt die Berliner Mauer – Sinnbild des Kalten Krieges, gebaute Geschichte und Mahnmal europäischer Entwicklungen.

Straßenbahn vor dem Alten Stadthaus in Berlin-Mitte (um 1955). / © Foto: Bundesarchiv Bild 183-28540-0004 / Wikimedia Commons
Quellen: Landesarchiv Berlin, Stiftung Berliner Mauer, Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Bundeszentrale für politische Bildung, Deutsches Historisches Museum, Landesdenkmalamt Berlin, Chronik der Mauer