Im Rahmen einer mehrteiligen Reihe widmen wir uns der bewegten Geschichte der Berliner Friedrichstraße. Im dreizehnten und letzten Teil schauen wir auf die Entwicklung der Straße seit dem Mauerfall. Denn ab 1990 ergab sich abermals die Chance, die Friedrichstraße vollkommen neu zu erfinden – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Die Friedrichstraße in Berlin-Mitte heute, mit modernen Neubauten rund um den historischen Bahnhof unweit vom Schiffbauerdamm. / © Foto: Depositphotos.com
© Foto Titelbild: Depositphotos.com / Canva
Text: Wolfgang Leffler
DIE GESCHICHTE DER FRIEDRICHSTRASSE
Teil 13 – Der Traum vom Boulevard nach dem Mauerfall
Ist die Friedrichstraße wieder sie selbst? So wie man sie sich nach dem Niedergang der DDR – begünstigt durch den Mauerfall – vorgestellt oder gewünscht hat?
Zumindest eines kann man der heutigen Friedrichstraße attestieren – sie ist ein gutes Beispiel für die ureigenste Berlinwerdung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs.
Berlin im Jahr 2024: Ist die Friedrichstraße wieder sie selbst?
Wobei man bei der Friedrichstraße klar differenzieren muss zwischen dem Straßenabschnitt im ehemaligen Ostteil der Stadt, also vom Oranienburger Tor im Norden bis zum ehemaligen Grenzübergang am Checkpoint Charlie in der Kochstraße, und dem südlichen (politisch ehemals „westlichen“) Teil der Straße, ab der Kochstraße bis zum Mehringplatz.
Die Friedrichstraße galt einst als die pikanteste Verkehrsader und lebendigste Straße in Berlin mit einer ungemein hohen Dichte an Gebäuden, Geschäften, Hotels und gastronomischen Einrichtungen.
Konkurrenz für die Friedrichstraße: Die aufkommende City West in den 20er Jahren
Einen ersten Einschnitt in diese Dominanz erfuhr die Friedrichstraße mit dem aufkommenden Bürgertum in den zwanziger Jahren im Westen Berlins und dem damit einhergehenden Aufstieg des Kurfürstendamms.
Ein nicht mehr zu korrigierendes Negativereignis waren die massiven Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, welche somit die Beendigung des Trubels und des Glanzes einleitete.
Die Teilung der Friedrichstraße über Jahrzehnte in Ost und West und den damit verbundenen unterschiedlichen Gestaltungskonzepten versetzte dem 3,3 Kilometer langen Straßenzug vollends den Garaus.
Der West-Berliner Teil der Straße verkam zu einem tristen Straßenzug
Der zu West-Berlin gehörende Teil der Straße verkam zu einem mehr oder weniger tristen Kreuzberger Straßenzug. Bei der auf Ost-Berliner Territorium angesiedelten, „klassischen“ Friedrichstraße wurde seitens des Ost-Berliner Magistrats versucht, mit architektonisch großen, aber sehr aufwendigen Bauten, einen Glanz aufzusetzen als Ausdruck eines neuen und starken realen Sozialismus.
Nun gab es ab 1990 also eine neue Chance nach dem Mauerfall, den ehemaligen Boulevard wieder auferstehen zu lassen. Mit keiner anderen Straße Berlins verbanden sich danach so viele Hoffnungen und Illusionen zur Neugestaltung und Wiederherstellung des alten und beliebten Boulevards wie mit der Friedrichstraße.
Gab es für die Friedrichstraße überhaupt einen Bebauungsplan?
Aber gab es denn zur Neugestaltung der Friedrichstraße zu Beginn der neunziger Jahre überhaupt einen Bebauungsplan? Nein, den gab es seitens des Berliner Senats nicht, und niemand zog es auch nur in Betracht, das dafür Notwendige in die entsprechenden Bahnen zu leiten.
Immer mal wieder hörte man, dass zwischen den ‚Linden‘ und der ‚Leipziger Straße‘ kleine gehobene Geschäfte und Büros angesiedelt werden sollen, mehr war aber auch nicht angedacht.
Fehlende Ideen: Was sollte aus der „neuen“ Friedrichstraße werden?
Was also sollte aus der „neuen“ Friedrichstraße werden, eine Banken- und Einkaufsgegend, die nachts so tot ist, wie es Besucher in der Frankfurter Zeil oder der New Yorker Fifth Avenue erlebt haben?
Hätte man nicht in weiser Voraussicht Alternativen suchen und Vergleiche anstellen können, mit dem New Yorker Broadway etwa, wo das turbulente Treiben erst nach Einsetzen der Dunkelheit beginnt?
Ein mögliches Vorbild: Der Broadway in New York City
Der Vergleich mit dem Broadway liegt insofern auf der Hand, als es in Europa kaum eine vergleichbare Stadt gibt, die – wie die Berliner Friedrichstraße mit ihrem unmittelbaren Einzugsgebiet – eine so hohe Dichte an Theatern, Bühnen und kulturellen Spielstätten zu bieten hat.
Und da man diese Überlegungen und Betrachtungen nicht anstellte, entstand ab 1991 in der Friedrichstraße ein Straßenbild, das geprägt wurde von einer Blockbauweise mit Büro- und Geschäftshäusern von ausschließlich privaten Investoren.
Nur private Investoren gestalteten die Friedrichstraße in den 90er Jahren
Und diese privaten Investoren hatten wenig Zeit für kreative Experimente, da sie meinten, in der Friedrichstraße eine Goldgrube entdeckt zu haben.
Die Friedrichstraße wurde zum Magneten von ‚Investorengemeinschaften‘, die kein Interesse an der Gestaltung einer pulsierenden Straße hatten. Für diese Investoren zählen nur die Renditen. Es war daher fast absehbar, dass die Friedrichstraße bald die ‚teuerste Straße Deutschlands‘ sein würde.
Die Friedrichstraße: Die „teuerste Straße Deutschlands“
Der Spiegel berichtete 1996 darüber und hob dabei das wohl teuerste Neubauprojekt hervor, die ‚Friedrichstadtpassagen‘ mit einer geschätzten Bausumme von 1,4 Milliarden D-Mark.
Der bevorstehende Umzug der Bundesregierung in die neue Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland schürte natürlich hohe Erwartungen an die in der Warteschleife bereitstehenden Verbände, Institutionen und weiteren namhaften Interessenten.
Bis 1995 waren in der Friedrichstraße 500.000 m² Bürofläche in Planung
Bis 1995 waren in der Friedrichstraße bereits 500.000 Quadratmeter Büroflächen in Bau oder noch in Planung. Vor dem Zweiten Weltkrieg beschrieb man die Friedrichstraße als einen „Straßenzug mit mehr Lokalen als Hausnummern„, ein Ausdruck dessen, dass ein Häuserblock ein Stück Stadt selbst war, mit einer ungemein hohen Anzahl von Parzellen, die wiederum von der Gestaltung her stark differenziert angelegt waren.
Die neuen Investoren und ihre Bauherren, die in den neunziger Jahren ihr Kapital in der Friedrichstraße vermehren wollten, hatten es eilig und wollten sich ungern etwas vorschreiben lassen. So kauften sie ganze Blocks, die schnell bebaut werden sollten.
Die hohe Parzellierung der Friedrichstraße ging verloren
Diese hohe Parzellierung, die noch vor dem Zweiten Weltkrieg das Straßenbild beherrschte, hatte wiederum eine hohe Individualisierung zur Folge, mit vielen Plänen, Träumen, Fassaden, Hauseingängen, Fenstergestaltungen und Hinterhöfen. Wer schon einmal in Rom von der Piazza del Popolo vom Süden her in der Via del Corso Richtung Zentrum spaziert ist, kann diese hohe Individualität erleben und genießen.
Übrigens war die Piazza del Popolo, mit ihren von der Piazza aus angelegten drei Straßenzügen Via del Corso, Via del Babuino und Via del Ripetta anfangs des 18.Jahrhundert in der damaligen Residenzstadt des Preußenkönigs die Vorlage zur architektonischen Gestaltung der Friedrichstraße ab dem Belle-Alliance-Platz (heute Mehringplatz) mit den drei Straßenzügen Friedrich-, Wilhelm – und Lindenstraße.
Nach dem Mauerfall: Keine Hochhäuser in der Friedrichstraße
Aber damit war es nun vorbei und, obwohl es keinen von der Senatsverwaltung vorgegebenen Bebauungsplan gab, wurden doch gewisse Vorschriften zur Bebauung der Friedrichstraße erlassen, nach denen sich die Bauherren zu richten hatten.
Diese sahen vor, dass keine Hochhäuser gebaut werden dürfen. Die Traufhöhe beträgt 22 Meter, von dieser Höhe aus war es noch erlaubt, von der Straßenfront zurückgesetzt, weitere Geschosse aufzusetzen. In der heutigen Zeit favorisieren Architekten und Bauherren im Innenstadtbereich bei ihren Entwürfen kaum noch Walm- oder Satteldächer, da die Bauherren finanziell verwertbare Geschossflächen bevorzugen.
Der Anteil von Wohnungen wurde zu niedrig angesetzt
Die Senatsbaudirektion legte daher fest, dass bei einer Neubebauung eines Blockes mindestens ein Wohnanteil von zwanzig Prozent zu berücksichtigen sei. Das mussten nicht unbedingt Wohnungen im klassischen Sinne sein, sondern diese Wohnbebauung ging mehr in die Richtung von ‚Madison City Suite‘, oder ‚Boardinghaus‘. Weitere Varianten zur Wohnbebauung waren etwa ‚dinks‘ -Appartements für Menschen mit ‚double income, no kids‘.
Diese Grundorientierung am ‚Berliner Block‘, einer rechteckigen Grundfläche also, konnte mit vielen unterschiedlichen Vorder- und Hinterhäusern bebaut werden und offerierte den verantwortlichen Architekten zwei Möglichkeiten: Eine eher monoton wirkende Fassade, die den ganzen Block umfasste oder eine Blockfront mit verschiedenen Hausfassaden innerhalb eines Blocks, die die Wucht bei der Fassadengestaltung abminderte. Nach diesen Vorgaben wurde dann auch gebaut.
Moderne Neubauten wurden in großen, zusammenhängenden Blöcken gebaut
Nennenswerte Beispiele der Neubebauung sind das ‚Kontorhaus Mitte‘, Block oder Quartier 109, zwischen der Kronen- und Mohrenstraße gelegen, die Komplettierung des Blocks oder Quartiers 208, angesiedelt zwischen der Friedrich-, Behren-, Charlotten- und Französischer Straße.
Die Bebauung der Quartiere 205, 206 und 207 mit den ‘Friedrichstadtpassagen‘ als größtes Neubauvorhaben gehört natürlich unbedingt dazu. Auch erwähnenswert ist das im Jahr 1997 eröffnete ‚Kulturhaus Dussmann‘.
Peter Dussmann realisierte 1997 das „Kaufhaus Dussmann“
Das Grundstück zwischen Friedrich-, Dorotheen- und Mittelstraße wurde von Investor Peter Dussmann erworben, der sich anfangs den Vorschriften der Senatsbauverwaltung nicht beugen wollte, sich letztendlich aber mit dem Entwurf des Architekten Wolv anfreunden musste.
Dussmanns Vorwurf an die damalige Senatsbaudirektion mündete darin, dass er den Entwurf für sein Gebäude als „Zigarrenkiste“ empfand, als „Tiefkühlarchitektur„, während der Senatsbaudirektor in einem historischen Bankpalais in der Behrenstrasse residierte. Dussmann selbst hätte gern auch historisch ansehnliche Fassaden für sein Gebäude bevorzugt.
Nicht alle Immobilien in der Friedrichstraße waren leicht zu vermieten
Aber so lukrativ die Kapitalanlage in Immobilien der Friedrichstraße auch schien, in der Realität gab es schon die eine oder andere Pleite. Die Eigennutzung der Immobilie war nicht immer gegeben, so wie bei Peter Dussmann, der keine Vermietungsschwierigkeiten hatte, da er als Eigentümer sein Geschäft im eigenen Haus betrieb und dazu noch breit aufgestellt war.
Trotz Sonderkonditionen und verlockenden Dienstleistungsangeboten gelang es bei der Vermietung von Büroflächen nicht immer, den Leerstand zu reduzieren. 1997 erwischte es die Kirschner-Gruppe aus Westfalen, einer der ersten Investoren in der Friedrichstraße.
Die Kirschner-Gruppe ging in den 1990er Jahren pleite
Die Gruppe erwarb Anfang der neunziger Jahre von der Treuhand das bekannte ‚Mädler-Haus‘ an der historischen Ecke Leipziger Straße / Friedrichstraße und sanierte es aufwendig. Nach Ende der Sanierungsarbeiten fanden sich aber weder Mieter, geschweige denn Käufer.
Da der Regierungsumzug sich weitaus länger hinzog als geplant, standen die Büroräume dementsprechend leer. Da die Gläubiger-Banken seit der Schneider-Affäre in Leipzig gewarnt waren und vorsichtig agierten, provozierten sie für die Kirschner-Gruppe letztendlich den Konkurs.
Friedrichstraße: Zu hohe Kaufkrafterwartung in den 90er Jahren
Die Verkündung des ‚neuen Boulevard‘ Friedrichstraße führte zu spekulativen Bodenpreisen, die 1999 lapidar mit 25.000 D-Mark pro Quadratmeter angegeben wurden. Dazu kamen zu schnell gefasste und zu weit gegriffene, globalisierte und abgeschliffene Nutzungsvorstellungen.
Die total überschätzten, hohen Kaufkrafterwartungen führten in einigen Fällen zu einer Fehlleitung des Bankenkapitals, so dass aufgrund solcher Umstände Anfang der neunziger Jahre dieses Kapital in den jeweiligen Unternehmungen versackte. Mindestens einer Großbank brach dieses Geschäftsgebaren den Hals.
Kleine und mittlere Gewerbe wurden viel zu wenig berücksichtigt
Bei der Neukonzipierung der Friedrichstraße nach dem Mauerfall räumte man den kleineren und lokaleren Interventionen und Gewerben viel zu wenig Raum ein, die Chance dazu war eigentlich aber vorhanden.
Das Wenige an historischer Bausubstanz, das noch vorhanden war, blieb nur aufgrund massiver Einwände des Denkmalschutzes stehen, ansonsten hätte man noch viel mehr sanierungsfähige Altbauten abgerissen, als es tatsächlich erforderlich gewesen wäre.
Wie sieht die Zukunft der heutigen Friedrichstraße aus?
Spaziert man Im Frühling 2024 durch die Friedrichstraße, präsentiert sie sich nicht bloß als eine Neubaustraße, sondern man erlebt sie mit den Eigenschaften, die sich speziell nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs, dem Mauerbau und Teilung der Stadt, sowie den danach unterschiedlich ausgefallenen Gestaltungsprinzipien in Ost und West entwickelt haben.
Der Fall der Mauer und die danach vorhandenen, völlig neuen Gestaltungsmöglichkeiten des wieder vereinten Berlins haben zumindest für die mittlere und nördliche Friedrichstraße die Möglichkeiten eröffnet, um dem versprochenen ‚Boulevard‘ wieder etwas Glanz zu verleihen.
Der Neubau der nördlichen Friedrichstraße ist in Teilen gelungen
Das ist insofern gelungen, als dass man beim Eintritt in die Friedrichstraße sofort weiß, wo man sich befindet, denn das ist keine Straße irgend einer anderen deutschen Großstadt, die sich durch den Bauboom der Nachkriegsjahre bis in die achtziger Jahre hinein in den Kernzonen der Städte oft durch ein seltsames Durcheinander auszeichnen.
So widersprüchlich man die Friedrichstraße vom Mehringplatz bis zum Oranienburger Tor auch empfindet, so hat sie doch eine unverwechselbare Individualität mit den historischen Fluchtlinien und beschichteten Oberflächen, die eine Einheit bilden und nicht auseinanderfallen.
Die historischen Fluchtlinien der Friedrichstraße sind bis heute erhalten
Trotz der anfangs sicher nicht unberechtigten Kritik bei der Neugestaltung der Friedrichstraße muss man doch feststellen, dass hier architektonisch kein kategorialer Bruch stattfand, so wie man das beim alten und neuen Hansa-Viertel oder dem alten und neuen Alexanderplatz erlebt hat und bis heute erlebt.
Betritt man die Friedrichstraße heute, verbindet man vor dem geistigen Auge schnell die Erinnerungsbilder der historischen Friedrichstraße, der Straße während der Jahrzehnte der Teilung und die nach dem Mauerfall neu entstandenen Straßenzüge.
Berlins wechselvolle Geschichte wird in der Friedrichdstraße sichtbar
Berlins wechselvolle (Bau-) Geschichte, die im internationalen Vergleich sehr einzigartig ist, wird in der Friedrichstraße besonders gut sichtbar. Daraus sollte man Rückschlüsse ziehen für zukünftige Bauvorhaben in der Stadt.
Und natürlich zeichnet die Friedrichstraße diese ‚Gerade‘ aus, diese streng nach ‚preußischem Baurecht‘ vorgeschriebene Traufhöhe von maximal 22 Metern. Daher kann man diesen 3,3 Kilometer langen Korridor komplett einsehen, ohne durch Auswölbungen an den Fassaden oder störende Bauwerke beeinträchtigt zu werden.
Die Friedrichstraße profitiert noch immer von der linearen, barocken Achse
Dies hat die Friedrichstraße übrigens anderen deutschen Magistralen, etwa in München oder Düsseldorf, voraus, die einhundert Jahre später angelegt wurden. Denn in ihrer Linearität und ‚virtuellen Unendlichkeit‘ bleibt die Friedrichstraße das Vorbild.
Diese Magie der barocken Achse, in italienischen Großstädten wie Rom, Turin und Florenz immer wieder zu sehen, wird in der Friedrichstraße und speziell in der Friedrichstadt strikt eingehalten. Die Sichtachse wird durch keine links oder rechts der Blöcke verbauten Ausbuchtungen beeinträchtigt.
Die Friedrichstraße ist bei Touristen wieder ausgesprochen beliebt
Letztendlich kann man doch mit Fug und Recht sagen, dass die Friedrichstraße wieder wie die Friedrichstraße aussieht. Darüber haben übrigens längst die Füße der Touristen entschieden, die in Scharen durch die Friedrichstraße wandeln – nicht nur wegen des Checkpoint Charlie.
Die Zahl der Besucher ist auch deswegen so hoch, weil die Friedrichstraße mittlerweile ein kulinarisches Angebot bietet, welches in seiner Vielfältigkeit, Qualität und Fülle in der Stadt kaum zu überbieten ist.
Internationale Boutiquen und Geschäfte sind in der Friedrichstraße zu finden
Auch die internationalen Boutiquen und Geschäfte geben der Mitte Berlins ein Flair von ‚Lifestyle‘, Luxus und mondäner Eleganz. Daher ist es zu bedauern, dass das Quartier 206 mit dem momentanen Betreiber ‚Galerie Lafayette‘ nach dem Sommer 2024 seine Zelte dort abbricht.
Die derzeit vom Berliner Senat diskutierte Nachnutzung (Standort der Zentral- und Landesbibliothek) des Quartiers 206 ist der falsche Ansatz und trägt sicher nicht zur Aufwertung der Friedrichstraße bei. Auch die Aufhebung des PKW-Fahrverbots durch den neu gewählten Berliner Senat war der derzeit guten Stimmung nicht abträglich.
Die Friedrichstraße profitiert von der Nähe zu vielen kulturellen Hotspots
Die Friedrichstraße ist neben Kurfürstendamm und Tauentzien der dritte Anziehungspunkt in Berlin, kann aber aufgrund der Nähe zu vielen kulturellen Einrichtungen und eines riesigen historischen Bezugs zur Innenstadt eine Sogwirkung entfalten, die andere Konsumzentren der Stadt nicht vorzuweisen haben.
Wenn Touristen nach Berlin kommen, geht es aber eben nicht immer nur um Konsum, sondern auch um Kultur und Sehenswürdigkeiten – und die kann man wohl mit den umliegenden Quartieren, wie dem Boulevard Unter den Linden, der Leipziger Straße, dem Humboldt Forum oder dem Gendarmenmarkt, kaum besser erleben.
Die Besucher sollten auch abends in der Friedrichstraße gehalten werden
Um der Friedrichstraße, der historischen Mitte Berlins insgesamt, zukünftig zu mehr Attraktivität zu verhelfen, sollte der Berliner Senat in einer breit angelegten Analyse zum Ist-Zustand des Areals untersuchen, wie es mit dem Kaufverhalten, der Einwohnerstruktur, dem Arbeitsplatzangebot und dem Leistungsangebot der Geschäfte und Lokale rund um die Friedrichstraße aussieht, die unter Umständen mit veränderten Öffnungszeiten mit dazu beitragen können, die Besucher länger im Quartier zu halten, was dem Flair der Straße sicher gut zu Gesicht stehen würde.
Die Investitionen in die Neugestaltung der Friedrichstraße nach dem Wegfall der Mauer haben dazu beigetragen, in der historischen Mitte Berlins eine neue Magistrale entstehen zu lassen, die auch den Mythos der Friedrichstraße wieder belebt hat.
Doch die Berliner Politik sollte mit Kreativität und Mut das Ziel verfolgen, die Straße auch in den Stunden nach Ladenschluss deutlich attraktiver und interessanter zu gestalten. Denn der Standort der Friedrichstraße im heute wieder vereinten Berlin ist eigentlich unschlagbar.
Weitere Bilder zur Friedrichstraße findet Ihr hier:

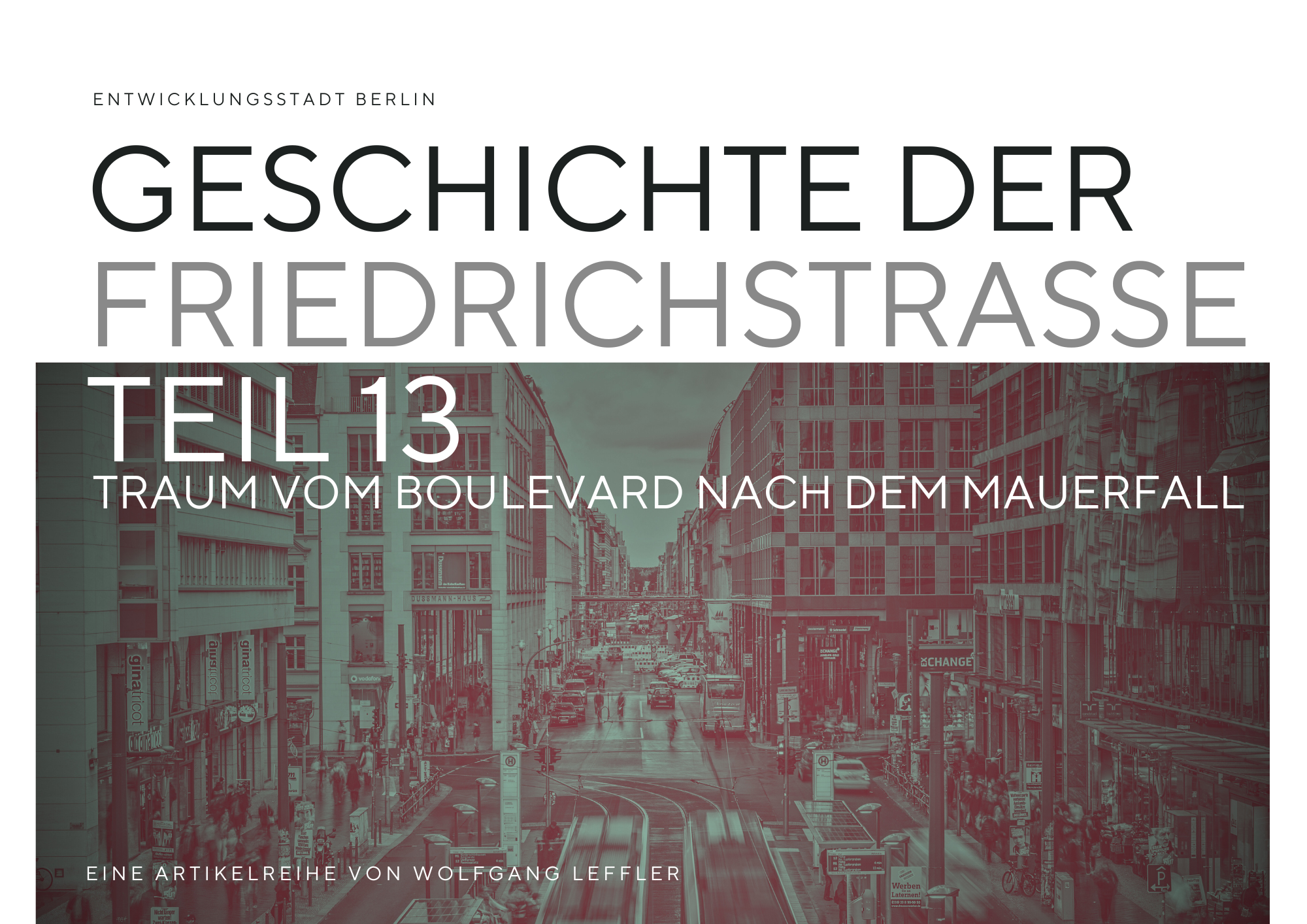








Kommentare sind deaktiviert.